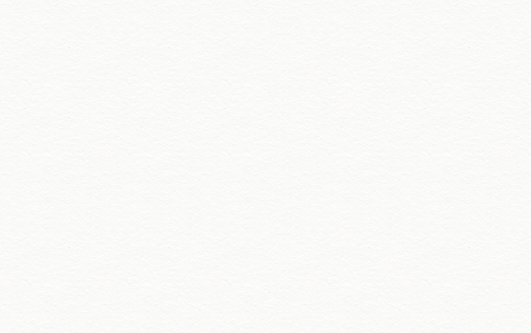Abschlusskonferenz von Skills2Capabilities: Evidenz in Handlung umsetzen
 Von 13.–14. November 2025 lud das Skills2Capabilities-Konsortium zu seiner Abschlusskonferenz im Bonnefantenmuseum in Maastricht. Rund 80 Teilnehmer:innen – darunter Konsortialpartner, Mitglieder des Advisory Boards, internationale Forschende, politische Expert:innen sowie Vertreter:innen von Ministerien, Gewerkschaften, Bildungsbehörden und Berufsverbänden – kamen zusammen, um die Ergebnisse aus drei Jahren Forschung zu diskutieren und zu fragen, wie ein responsives, proaktives und widerstandsfähiges Kompetenzsystem der Zukunft aussehen sollte.
Von 13.–14. November 2025 lud das Skills2Capabilities-Konsortium zu seiner Abschlusskonferenz im Bonnefantenmuseum in Maastricht. Rund 80 Teilnehmer:innen – darunter Konsortialpartner, Mitglieder des Advisory Boards, internationale Forschende, politische Expert:innen sowie Vertreter:innen von Ministerien, Gewerkschaften, Bildungsbehörden und Berufsverbänden – kamen zusammen, um die Ergebnisse aus drei Jahren Forschung zu diskutieren und zu fragen, wie ein responsives, proaktives und widerstandsfähiges Kompetenzsystem der Zukunft aussehen sollte.
Den Auftakt bildeten die Begrüßung von Gastgeber Didier Fouarge (ROA) und ein Vortrag von Terence Hogarth (IER), der nochmals den ursprünglichen Anspruch von Skills2Capabilities hervorhob: Theorien zu testen und innovative Konzepte der Kompetenzentwicklung zu erarbeiten, die Bildungssysteme befähigen, lebenslanges Lernen zu fördern. Die Leitfrage, die er stellte, prägte die weiteren Diskussionen: Wie kann das Angebot an Kompetenzen besser auf die Nachfrage abgestimmt werden – und wie können Berufsbildung und Erwachsenenbildung wirksam auf sich wandelnde Arbeitsmärkte reagieren?
Keynote: Sandra McNally zur Zukunft beruflicher Qualifizierung
In ihrer Keynote „Developing a skilled workforce for the future: the role of vocational education“ diskutierte Sandra McNally (LSE & University of Surrey), wie technologischer Wandel – insbesondere KI – Kompetenzanforderungen verändert und soziale Ungleichheiten verschärfen könnte. Zudem beleuchtete sie Chancen und Grenzen von hochwertigen beruflichen Bildungswegen im Sekundarbereich (z. B. UTCs im Vereinigten Königreich), und betonte, dass berufliche Bildung Bildungswege öffnen statt verschließen muss.
Policy-Pitches: Zentrale Erkenntnisse aus Skills2Capabilities
 In kurzen, hochverdichteten Präsentationen, moderiert von Triin Roosalu (TLU), wurden dann Forschungsergebnisse aus den Work Packages vorgestellt, wobei folgende Themen angeschnitten wurden:
In kurzen, hochverdichteten Präsentationen, moderiert von Triin Roosalu (TLU), wurden dann Forschungsergebnisse aus den Work Packages vorgestellt, wobei folgende Themen angeschnitten wurden:
- nationale Weiterbildungsstrategien und LLL-Politiken (Daniel Unterweger, 3s)
- Governance- und Curricula-Vergleiche zur Reaktionsfähigkeit von Berufsbildungssystemen (Torgeir Nyen, FAFO)
- Einsatz von Machine Learning (v. a. LLMs) zur Analyse von Stellenangeboten und Kompetenznachfrage (Katarina Weßling, ROA/BIBB)
- neue Perspektiven auf Skill Mismatch auf Basis des Capability-Ansatzes (Joanna Kitsnik, TLU)
- institutionelle Reaktionen auf sich wandelnde Arbeitsmarktanforderungen (Didier Fouarge, ROA)
- die Rolle von Politik, Arbeitsmarktverwaltung und Stakeholdern in der Steuerung von Berufsbildungspolitiken (Jaana Kettunen, JYU)
- Entwicklung der Finanzierung beruflicher Bildung (Emily Erickson, IER)
Poster Session & Panel: Angebotsorientierung und Nachfrageorientierung zusammenführen
 Nach einer Postersession mit vertiefenden Austauschmöglichkeiten zu den Ergebnissen der Arbeitspaket moderierte Didier Fouarge (ROA) ein hochrangig besetztes Panel mit Hubert Ertl (BIBB), Glenda Quintini (OECD), Kirak Ryu (KRIVET), Inga Balnanosienė (Lithuanian PES & EU PES Network) und Emilio Dogliani (EfVET). Diskutiert wurden u. a.:
Nach einer Postersession mit vertiefenden Austauschmöglichkeiten zu den Ergebnissen der Arbeitspaket moderierte Didier Fouarge (ROA) ein hochrangig besetztes Panel mit Hubert Ertl (BIBB), Glenda Quintini (OECD), Kirak Ryu (KRIVET), Inga Balnanosienė (Lithuanian PES & EU PES Network) und Emilio Dogliani (EfVET). Diskutiert wurden u. a.:
- die gleichzeitige Zunahme von Beschäftigung und Skill Mismatch
- der Wandel von angebots- zu nachfrageorientierten Ansätzen in den letzten 15 Jahren
- Wege zur Verknüpfung beider Perspektiven
- lebenslange Berufsorientierung, Kompetenzen für Übergänge und berufliche Mobilität
- Arbeitszufriedenheit („Arbeitsvergnügen“) und Unterstützung beim Zugang zum Arbeitsmarkt
Zweite Keynote: Berufe als Missing Link?
Den Abschluss des ersten Tages bildete die Keynote „Occupations as the link between education and work: how well does this idea travel?“ von Stephanie Matseleng Allais (University of the Witwatersrand). Sie diskutierte, ob Berufskonzepte als normative oder analytische Modelle tauglich sind und ob berufliche Ordnungen in Ländern mit unterschiedlichen ökonomischen Kontexten funktional übertragen werden können. Der Tag endete mit Schlussworten von Daniel Unterweger (3s).
Tag 2: Evidenz aus Skills2Capabilities und Schwesterprojekten
Moderiert von Joanna Kitsnik (TLU) und Petya Ilieva-Trichkova (IPS) wurden wissenschaftliche Beiträge aus dem Projekt und den Horizon Sister Projects diskutiert:
- Anpassungsstrategien des italienischen Skills-Systems (Clementina Croce, dSEA)
- Ergebnisse aus dem Schwesterprojekt MEGASKILLS (Katsiaryna Palishchuk)
- Multilevel-Analysen zu Skill Mismatch und Wohlbefinden (Petya Ilieva-Trichkova, IPS)
- Reaktionen beruflicher Curricula auf Veränderungen in England, Deutschland, Norwegen (Torgeir Nyen & Johan Røed Steen, FAFO)
- informelles Lernen und Fluktuation bei Neueinstellungen (Didier Fouarge, ROA)
- Leseförderung und Innovation aus dem Schwesterprojekt iRead4Skills (Raquel Amaro)
- 25 Jahre Finanzierung beruflicher Bildung in England (Terence Hogarth, IER)
Abschließende Reflexion: Dient unser Kompetenzsystem der Zukunft, die wir wollen?
In seinen Schlussworten knüpfte Konsortiumsleiter Jörg Markowitsch (3s) an die Maastricht-Studie (2005) und die Lissabon-Ziele an. Er stellte die grundlegende Frage, ob wir nur an die Anforderungen des Arbeitsmarkts anpassen – oder ob wir den Arbeitsmarkt gestalten wollen, für uns und für kommende Generationen. Dabei unterstrich er die Bedeutung der Berufsbildung nicht nur für Beschäftigungsfähigkeit, sondern auch für Innovation, soziale Teilhabe, Arbeitsintegration und individuelle Lebensqualität.
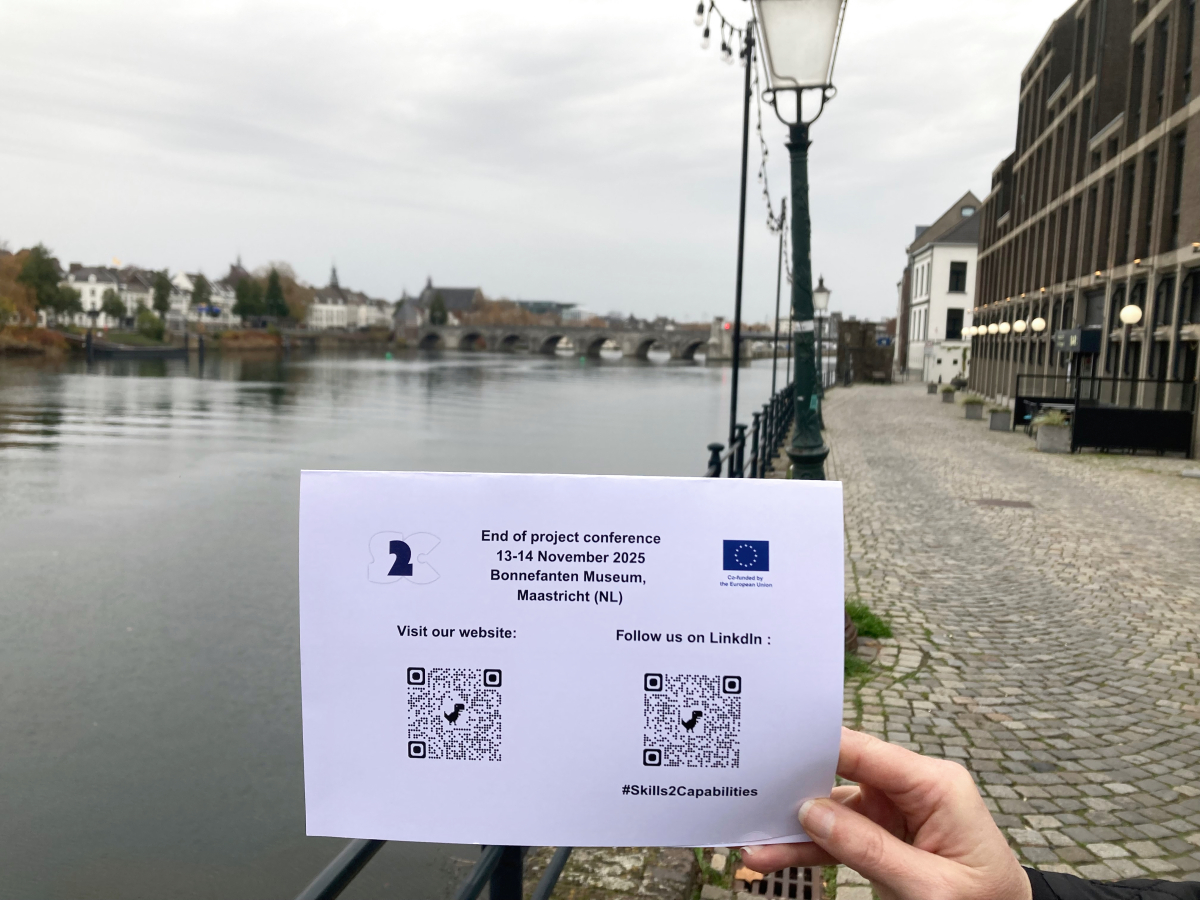
image by S2C consortium
Ansprechperson: Daniel Unterweger
Client: Horizon Europe