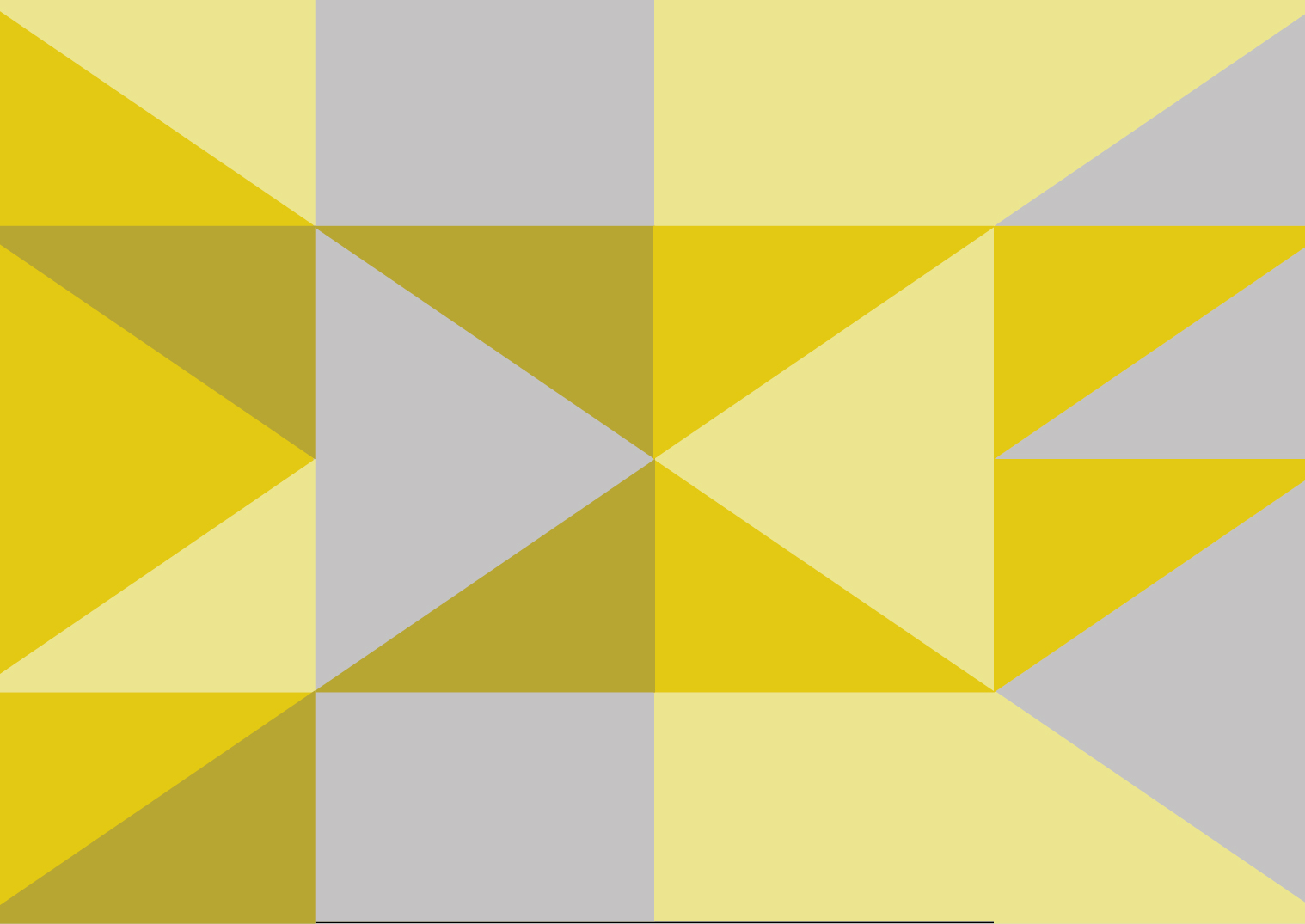Die Cedefop-Konferenz The impact of learning outcomes on teaching and learning: policy choices ahead bildete den Abschluss der dreijährigen Studie The shift to learning outcomes: rhetoric or reality?. Die Veranstaltung brachte europäische politische Entscheidungsträger:innen, Forscher:innen und Praktiker:innen zusammen, um zu reflektieren, wie Lernergebnisse die berufliche Bildung sowie die Beurteilungsverfahren – sowohl im schulischen als auch im betrieblichen Kontext wie z. B. in der Lehrausbildung – verändern.
Die Ergebnisse der umfangreichen Cedefop-Studie zeigen, dass Lernergebnisse zunehmend zur Steuerung von Lehrplänen in der beruflichen Bildung eingesetzt werden, wobei es große Unterschiede im Verständnis und in der Umsetzung gibt. Die Konferenz bot eine Plattform, um die Auswirkungen auf Lehren und Lernen, Bewertung und die Einbindung von Stakeholdern zu diskutieren.
Die Teilnehmenden konnten sich in vier thematischen Workshops einbringen:
- Einbindung von Stakeholdern in die Umsetzung von Lernergebnissen, um gemeinsames Verständnis und „Ownership“ zu gewährleisten,
- Stärkung von Lehrkräften und Ausbilder:innen für die Verwendung von Lernergebnissen,
- Abstimmung von Lehren und Lernen mit Prüfungs- und Bewertungsverfahren,
- Werkzeuge zum Austausch von Praxiswissen und zur Verbesserung der Umsetzung der Lernergebnisorientierung in der Praxis.
Das Abschlusspanel vereinte vielfältige Perspektiven aus Politik und Praxis und betonte die Notwendigkeit eines fortlaufenden Dialogs, der Unterstützung von Lehrkräften sowie der besseren Abstimmung von Lernergebnissen mit realen Lehr- und Lernprozessen.
Karin Luomi-Messerer wirkte als Vortragende mit, Monika Auzinger und Mariya Dzhengozova übernahmen eine aktive Rolle als Rapporteurinnen aus den Breakout Sessions.
Alle Präsentationen stehen zum Download zur Verfügung.





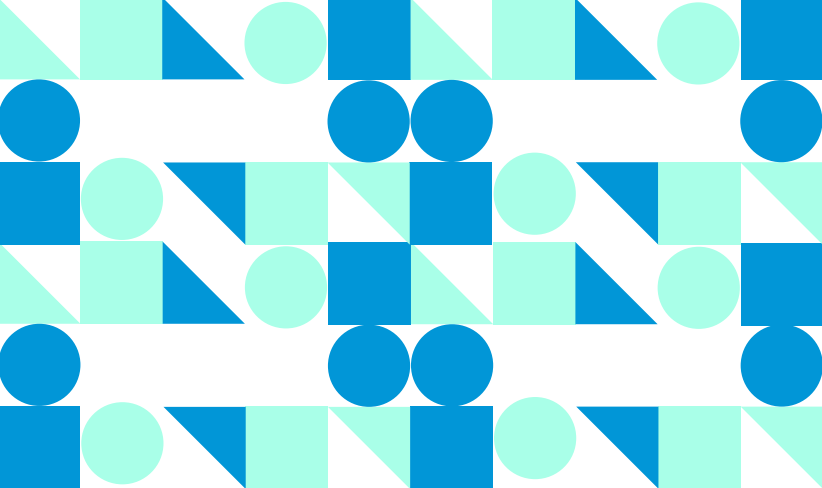
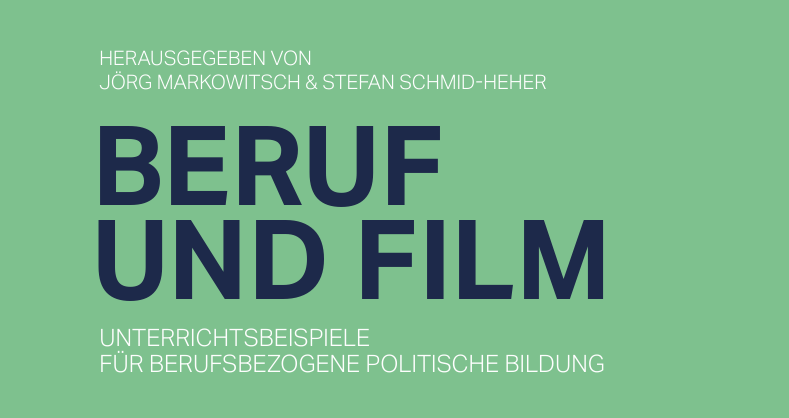
 Die Publikation ging aus dem Projekt
Die Publikation ging aus dem Projekt